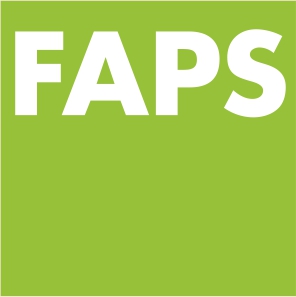Index
Elektromaschinenbau (E|MB)
Elektromaschinenbau – Grundlagen (E|MB) und Vertiefung
Vorlesung, 4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
Inhalt
Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden zu vermitteln, wie sich die Wertschöpfungskette nach dem Entwurf, der Konzeption und der Konstruktion eines Produkts gestaltet. Anhand der Vorlesungseinheiten werden den Studierenden Einblick in die verschiedenen Eigenschaften der elektrischen Maschinen gewährt. Darüberhinaus werden anhand des Stands der Technik die verschiedenen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette, vom Blech über den Magneten und der Wicklung bis hin zur Isolation und der Prüfung des Produkts, vermittelt. Somit wird den Hörern der Vorlesung Elektromaschinenbau das nötige Wissen gelehrt, welches notwendig ist, laufende Produktionsprozesse von Serienprodukten stetig hinsichtlich Ökonomie und Energie- und Ressourceneffizienz zu verbessern sowie die Prozesse für die Umsetzung von Neuentwicklungen in die Serien- und Produktionsreife zu überführen. Im Rahmen der Vorlesung werden insbesondere folgende Punkte behandelt:
-
Allgemeine Grundlagen zu elektrischen Maschinen
-
Weichmagnetische Werkstoffe
-
Hartmagnetische Werkstoffe
-
Wickeltechnik
-
Isolationstechnologien
-
Statorprüfung
-
Produktion und Endmontage elektrischer Maschinen
-
Produktion elektrischer Maschinen für Traktionsantriebe
-
Spezielle Anwendungsfelder des Elektromaschinenbaus
-
Recycling elektrischer Maschinen
-
Elektronik im Elektromaschinenbau
Empfohlene Literatur
Tzscheutschler – Technologie des Elektromaschinenbaus
Jordan – Technologie kleiner Elektromaschinen
Strategisches Qualitätsmanagement
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Lehrveranstaltungen:
Strategisches Qualitätsmanagement
Startsemester: WS 2019 / 2020 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)
Präsenzzeit: 30 Std. Eigenstudium: 45 Std. Sprache: Deutsch
Inhalt:
Die Vorlesung richtet sich an alle Studierenden, die sich anwendungsnah für das Thema strategisches Qualitätsmanagement interessieren. Dabei werden die Themen Strategie und Entscheidungen in Unternehmen differenziert und deren Bedeutung praxisnah erläutert. Zudem wird der Zusammenhang zwischen Strategie und Qualitätsmanagement inklusive passender Methoden und Werkzeuge vertieft und an Beispielen aufgezeigt.
Folgende Thematischen Schwerpunkte werden behandelt
- Entscheidungswege für die strategische und operative Ausrichtung von Unternehmen
Wie kann das Qualitätsmanagement diese Entscheidungsprozesse positiv begleiten und beeinflussen? Wie sieht auf der strategischen Ebene ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess aus? - Ableitung der wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens
Markt, Produkte, Produktion, Organisation, Controlling-System, Aufgabe und praktische Einbindung des QM-Systems, Einflussfaktor Mensch in der Organisation. - Erarbeitung wesentlicher Erfolgsfaktoren in Industrieunternehmen
Definition von Erfolgsparametern, Ableitung von Erfolgsparametern, Mitarbeiterakzeptanz, Betriebswirtschaftliche Analyse von Verbesserungsprozessen. - Aufgabe des Qualitätsmanagements
Was verlangt die DIN/ISO? Was braucht das Unternehmen? Welche Qualifikation braucht der Qualitätsmanager? - Planspiel “Kontinuierliche Verbesserungsprozesse an einem Beispiel”
Gruppenarbeit.
Lernziele und Kompetenzen:
Nach dem Besuch des Moduls sind die Teilnehmenden in der Lage,
Wissen:
-
die Begriffe des Total Quality Managements (TQM) anhand industrieller Unternehmen wiederzugeben
Verstehen:
-
die Veränderungen von der Qualitätssicherung zum Total Quality Management (TQM) zu erläutern
-
den strategischen Managementprozess darzustellen
-
den operativen Prozess eines industriellen Beispiels (Messingwerk) zu beschreiben
-
die Aufgabe des Qualitätsmanagements zur Definition und Erreichung strategischer Ziele aufzuzeigen
Anwenden:
-
eine Umwelt- und Unternehmensanalyse durchzuführen
Analysieren:
-
wesentliche Erfolgsfaktoren eines Unternehmens zu erarbeiten
-
wirtschaftliche Erfolgsfaktoren eines Unternehmens zu bestimmen
Evaluieren:
-
das Verbesserungspotential von ausgewählten Verbesserungsprojekten zu beurteilen
Erschaffen:
-
konkrete Verbesserungsmaßnahmen auf Basis der vorhergehenden Analysen abzuleiten
-
strategische Zielrichtungen eines Unternehmens am Beispiel eines virtuellen Messingwerkes zu entwickeln
Literatur:
- Kamiske, G. F.; Brauer, J.-P.: Qualitätsmanagement von A – Z, Carl Hanser Verlag, München 2005
-
Masing, W.; Ketting M.; König. W.; Wessel, K.-F.: Qualitätsmanagement – Tradition und Zukunft, Carl Hanser Verlag, München 2003
Produktionssystematik (PS)
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Zeit und Ort:
Studienfächer / Studienrichtungen:
- PF IP-BA 4
- WPF WING-MA 1-3
- WPF WING-BA-MB-ING-MG5 4-6
- WPF MB-BA-FG5 3-6
- WPF MB-MA-FG5 1-3
- WPF ME-BA-MG10 5-6
- WPF ME-MA-MG10 1-3
- WPF INF-NF-MB ab 5
- WPF BPT-MA-M 3-4
- WPF MT-MA-GPP ab 1
Voraussetzungen / Organisatorisches
Prüfung: schriftlich, 120 min., nur zusammen mit der Übung zur Produktionssystematik (PS(Ü));
die Prüfung (5 ECTS) umfasst sowohl Vorlesungs- als auch Übungsinhalte
Ansprechpartner für organisatorische Fragen: M.Sc. Eva Fischer
Inhalt
Ziel dieser Vorlesung Produktionssystematik ist es, dem Studenten die gesamte Bandbreite der technischen Betriebsführung von der Planung, Organisation und technischen Auftragsabwicklung bis hin zu Fragen des Managements und der Personalführung, Entlohnung sowie Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung näherzubringen. Die Übung zur Vorlesung vertieft diese Themen.
www: https://www.studon.fau.de/studon/goto.php?target=cat_5756
Automotive Engineering (AutoEng)
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Lehrveranstaltungen:
Automotive Engineering
Startsemester: WS 2019 / 2020 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)
Präsenzzeit: 30 Std. Eigenstudium: 45 Std. Sprache: Deutsch
Inhalt:
Die Vorlesung ist an alle ingenieurwissenschaftliche Studiengänge und Studenten mit Interesse an einer Tätigkeit in der Automobilindustrie oder deren Umfeld gerichtet. Es werden die Themen der Produktentstehung bis zur Fertigung und Vertrieb beleuchtet. Dabei wird der Aspekt des interdisziplinären Agierens aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt. Zum einen werden Einblicke in die technische, konstruktive Umsetzung von wesentlichen Elementen eines Automobils gestreift, zum anderen sollen aber auch strategische und betriebswirtschaftlich bestimmende Größen vermittelt und deren Bedeutung für den Ingenieur vertieft werden. Ziel ist es ein Gesamtverständnis für den Komplex der Automobilindustrie zu vermitteln.
Folgende thematischen Schwerpunkte werden in der Vorlesung behandelt:
- Überblick über die Abläufe und Rahmenbedingungen für die Entwicklung in der Automobilindustrie.
- Die Produktentstehung
- Der Produktionsprozess in der Automobilindustrie
- Integrierte Absicherung
- Handelsorganisation: Markteinführung, Marketingkonzepte, Service und Aftermarket Strategien
- Elektrifizierung, Hybrid, alternative Antriebe
- Elektronik im Fahrzeug: Fahrerassistenz, Navigation, Kommunikation
- Neue Technologien für die Herstellung von Karosserien
- Passive und aktive Sicherheit. Trend und Markttendenzen, technische Lösungen
- Entwicklung der Fahrdynamik
- IT-Systeme in der Automobilindustrie
- Spitzenleistungen als faszinierende Herausforderungen (Designstudien, Experimentalfahrzeuge, Rennsport)
- Qualitätsmanagement
Lernziele und Kompetenzen:
Das Automobil ist zunehmend eines der komplexesten Industriegüter. Es ist geprägt durch gesellschaftliche Anforderungen, gesetzliche Restriktionen und unterschiedlichste Marktund Kundenwünschen weltweit. Lernen Sie die Herausforderungen für die Ingenieurwissenschaften in der Automobilindustrie kennen, die Zusammenhänge verstehen und die Lösungen zu erarbeiten. Nach besuch der Vorlesung sind die Studenten in der Lage:
- Einen Überblick über die Produktentstehung bin hin zur Serienentwicklung zu geben
- Die Produktionsprozesse im Automobilbau zu verstehen
- Supportprozesse wie die integrierte Absicherung zu verstehen
- Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Antriebstechnologien zu nennen
- Einen Überblick von Elektrik und Elektronik im Fahrzeug zu haben
- Einflüsse auf die Fahrzeugdynamik zu verstehen
Organisatorisches:
Prüfung: schriftlich, 60 min
Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:
Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:
[1] Maschinenbau (Bachelor of Science): ab 3. Semester
(Pro-Vers. 2009w | TechFak | Maschinenbau (Bachelor of Science) | Wahlmodule | Technische Wahlmodule)
Studien-/Prüfungsleistungen:
Automotive Engineering (Prüfungsnummer: 53401) (englischer Titel: Automotive Engineering)
Prüfungsleistung, KLausur, Dauer (in Minuten): 60, benotet
Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0%
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
- Automotive Engineering
Erstablegung: WS 2019 / 2020, 1. Wdh.: SS 2020, 2. Wdh.: keine Wiederholung
1. Prüfer: Jörg Franke
Industrie 4.0 – Anwendungsszenarien in Produktion und Service
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Inhalt:
Ehemalige Vorlesung: Engineering der Automatisierung und Digitalisierung der Fertigung
Die IT-Durchdringung in der produzierenden Industrie nimmt rasant zu. Der nutzenstiftende Einsatz von IT bei der Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen hat für Deutschland eine zentrale strategische Bedeutung. Diese Trends werden unter Begriffen wie „Industrie 4.0″ und „Industrial Internet” bzw. „Internet of Things” weltweit diskutiert. Dabei treffen doch recht unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. In der Vorlesung werden diese Trends und Visionen anhand von ausgewählten Anwendungsszenarien erläutert. Außerdem werden die dafür zum Verständnis notwendigen Grundlagen erklärt.
Ziele:
- Bewusstseinsschärfung bezüglich der Auswirkungen der Digitalisierung auf die produzierende Industrie
- Verständnis von Geschäftstreibern, technischen Möglichkeiten und deren Wechselwirkungen in der produzierenden Industrie
- Vermittlung Branchen- und Domänen-übergreifender Prozesse und Methoden in der produzierenden Industrie
Zusätzliche Informationen:
Erwartete Teilnehmerzahl: 40, Maximale Teilnehmerzahl: 40
Voraussetzungen / Organisatorisches
Ansprechpartner am Lehrstuhl FAPS: M.Sc. Jonathan Fuchs
Industrie 4.0 – Anwendungsszenarien in Produktion und Service (ASPS4.0)
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Inhalt:
Die IT-Durchdringung in der produzierenden Industrie nimmt rasant zu. Der nutzenstiftende Einsatz von IT bei der Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen hat für Deutschland eine zentrale strategische Bedeutung. Diese Trends werden unter Begriffen wie „Industrie 4.0“ und „Industrial Internet“ bzw. „Internet of Things“ weltweit diskutiert. Dabei treffen doch recht unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. In der Vorlesung werden diese Trends und Visionen anhand von ausgewählten Anwendungsszenarien erläutert. Außerdem werden die dafür zum Verständnis notwendigen Grundlagen erklärt.
Ziele:
- Bewusstseinsschärfung bezüglich der Auswirkungen der Digitalisierung auf die produzierende Industrie
- Verständnis von Geschäftstreibern, technischen Möglichkeiten und deren Wechselwirkungen in der produzierenden Industrie
- Vermittlung Branchen- und Domänen-übergreifender Prozesse und Methoden in der produzierenden Industrie
Lernziele und Kompetenzen:
Den Studierenden sollen die Auswirkungen der Digitalisierung auf die produzierende Industrie verdeutlicht und dadurch ein Bewusstsein für diese Entwicklungen geschaffen werden. Zusätzlich soll ein Verständnis für Geschäftstreiber, technische Möglichkeiten und deren Wechselwirkungen in der produzierenden Industrie sowie branchen- und domänenübergreifender Prozesse und Methoden vermittelt werden.
Die Vorlesung ist auf Basis der folgenden Leitlinien aufgebaut:
- Methodische und konsequente Trennung der Diskussion von Problemperspektive, konzeptioneller Lösungsperspektive und technischer Umsetzungsperspektive
- Umfassendes Gesamtverständnis bezüglich der oft sehr vielschichtigen wirtschaftlichen und technischen Zusammenhänge (zu Lasten eines tiefen technischen Detaildiskussion)
- Betonung des für einen Anwender gestifteten (geschäftlichen) Nutzens und der möglichen Alleinstellungsmerkmale für einen Standort Deutschland
Die Studierenden sind nach Besuch der Lehrveranstaltung in der Lage:
- die kontroversen und vielschichtigen Diskussionen im Umfeld der Digitalisierung in der Produzierenden Industrie in einen konsistenten Gesamtkontext einzuordnen
- anhand repräsentativer Beispiele den Unterschied zu verstehen zwischen dem aktuellen Stand der Technik und Forschung sowie den durch Industrie 4.0 postulierten Innovationshypothesen
- aufgrund der vermittelten Beispiele und Methoden durch eine Hinterfragung von Zielen und des wirtschaftlichen Nutzens die oft stark emotional geführten Diskussionen im Kontext von Industrie 4.0 zu versachlichen
Das im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vermittelte Wissen ist in allen Bereichen der industriellen Branchen, so z. B. im Automobilbau, der Informatik und Wirtschaftsinformatik, der Elektrotechnik und Medizintechnik und dem Maschinen- und Anlagenbau erforderlich.
Organisatorisches:
Ansprechpartner am Lehrstuhl FAPS: M.Sc. Jonathan Fuchs
Integrated Production Systems (Lean Management) (IPS)
Vorlesung und Übung, 4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 5
Inhalt:
- Konzepte und Erfolgsfaktoren von Ganzheitlichen Produktionssystemen
- Produktionsorganisation im Wandel der Zeit
- Das Lean Production Prinzip (Toyota-Produktionssystem)
- Die 7 Arten der Verschwendung (Muda) in der Lean Production
- Visuelles Management als Steuerungs- und Führungsinstrument
- Bedarfsglättung als Grundlage für stabile Prozesse
- Prozesssynchronisation als Grundlage für Kapazitätsauslastung
- Kanban zur autonomen Materialsteuerung nach dem Pull-Prinzip
- Empowerment und Gruppenarbeit
- Lean Automation – „Autonomation“
- Fehlersicheres Arbeiten durch Poka Yoke
- Total Productive Maintenance
- Wertstromanalyse und Wertstromdesign
- Arbeitsplatzoptimierung (schlanke Fertigungszellen, U-Shape, Cardboard Engineering)
- OEE-Analysen zur Nutzungsgradsteigerung
- Schnellrüsten (SMED)
- Implementierung und Management des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP, Kaizen)
- Überblick über Qualitätsmanagementsysteme (z.B. Six Sigma, TQM, EFQM, ISO9000/TS16949) und Analysewerkzeuge zur Prozessanalyse und -verbesserung (DMAIC, Taguchi, Ishikawa)
- Verschwendung im administrativen Bereich
- Spezifische Ausgestaltungen des TPS (z.B. für die flexible Kleinserienfertigung) und angepasste Implementierung ausgewählter internationaler Konzerne
Lernziele und Kompetenzen:
Nach erfolgreichem Besuch der Lehrveranstaltung sollen die Studenten in der Lage sein:
- Die Bedeutung Ganzheitlicher Produktionssysteme zu verstehen
- Lean Prinzipien in ihrem Kontext zu verstehen und zu beurteilen
- die dazu erforderlichen Methoden und Werkzeuge zu bewerten, auszuwählen und zu optimieren
- einfache Projekte zur Optimierung von Produktion und Logistik anhand des Gelernten im Team durchführen zu können
Organisatorisches:
Unterrichtssprache: Deutsch, Englisch
Voraussetzung: Kenntnisse aus Produktionstechnik 1+2, Betriebswirtschaft für Ingenieure
Technische Grundlagen des ressourcenschonenden und intelligenten Wohnens (vhb) (TGW)
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Inhalt:
Ebenso wie die Sektoren Verkehr und Industrie gerät auch das private Wohnen zunehmend in das Spannungsfeld aus Ressourcenschonung und demografischen Wandel.
Mit intelligenter Automatisierungstechnik ist es möglich, diesen Herausforderungen zu begegnen. Eine besondere Beachtung ist hier den soziologischen und ökonomischen Bedarfen zu schenken.
Folgende Themenschwerpunkte werden im Rahmen der virtuellen Vorlesung adressiert:
- Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung im privaten Umfeld
- Energieeffizient Wohnen mit intelligenter Automatisierungstechnik
- Steigerung von Sicherheit und Komfort durch nutzergerechte Hausautomation
- Betrachtung soziologischer, technologischer und ökonomischer Begleitfaktoren
Einführung in die Programmierung humanoider Roboter (NAORob)
Vorlesung und Übung, 4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 5
Empfohlene Voraussetzungen:
Programmiererfahrung in C++
Inhalt:
- Roboterkinematik (kinematischer Aufbau von Standard-Robotertypen, Koordinatentransformation)
- Bewegungssteuerung und -planung
- Grundlagen des zweibeinigen Laufens
- Rechnersehen mit OpenCV
- Selbstlokalisierung
- Programmierung verteilter Robotersysteme
- Einführung in das Framework Robot Operating System (ROS)
- Verwendung von ROS zur C++- Programmierung des humanoiden Roboters NAO
- Lösung einer Teamaufgabe im Rahmen der Veranstaltung
Lernziele und Kompetenzen:
Nach dem Besuch der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, eigenständig auch fortgeschrittene Aufgabenstellungen in der Robotik am Beispiel des humanoiden Roboters NAO beziehungsweise an anderen Roboterkinematiken umzusetzen.
Die Vorlesung vermittelt Kenntnisse aus folgenden Bereichen:
- Grundlagen der Robotik in Bezug auf humanoide Systeme
- Roboterkinematik (kinematischer Aufbau von Standard-Robotertypen, Koordinatentransformationen, direkte und inverse Transformation)
- Roboterprogrammierung und Softwareentwicklung
- Umgang mit dem Robot Operating System ROS
- Bewegungssteuerung und -planung
- Selbstlokalisierung in unbekannten Umgebungen
- Bildverarbeitung (OpenCV)
- Auswertung multimodaler Sensoren
Die Studenten erwerben und trainieren im Rahmen des Praktikums zusätzlich folgende Fähigkeiten
- Problemlösungsfähigkeit und analytisches Denken
- Projektmanagement und Teamarbeit
- Kommunikationsfähigkeit
Automatisierte Produktionsanlagen (APA)
Vorlesung und Übung, 4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
Inhalt:
Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden die grundlegenden Inhalte zum Aufbau und Betrieb Automatisierter Produktionsanlagen zu vermitteln. Zu Beginn wird grundlegendes Wissen bezüglich Elektromaschinen, Fluidantrieben, Sensoren und der Steuerungs- sowie Kommunikationstechnik vermittelt. Darauf aufbauend werden Systeme zur Vereinzelung, Bereitstellung und Handhabung von Werkstücken sowie die Einsatzgebiete von Werkzeugmaschinen vorgestellt. Nach der Vermittlung der Einzelkomponenten werden Lebenszyklus und Anwendungen von Automatisierten Produktionsanlagen beschrieben. Dazu werden flexible Fertigungssysteme in der Vorlesung definiert und Planungs- sowie Optimierungsansätze vorgestellt. Schließlich werden Softwarekomponenten zur rechnergestützten Diagnose, Qualitätssicherung und optimalen Auftragssteuerung betrachtet. Somit kann der Hörer die Komponenten einer Automatisierten Produktionsanlage bewerten und die ebenfalls in dieser Vorlesung vermittelten Methoden zur Planung, Optimierung und Inbetriebnahme Automatisierter Produktionsanlagen optimal anwenden. Zusätzlich werden im Rahmen der Vorlesung intelligente Digitalisierungs- und Vernetzungsansätze von Maschinen und Abläufen vermittelt. Im Rahmen der Vorlesung werden insbesondere folgende Punkte behandelt:
- Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things
- Elektrische und fluidtechnische Antriebe
- Sensoren und Steuerungstechnik
- Industrieroboter und Werkzeugmaschinen
- Produktionslogistik und Zuführtechnik
- Flexible Fertigungssysteme
- Planung und Optimierung von APA
- Auftragssteuerung
- Inbetriebnahme und Betrieb von APA
- Rechnergestützte Diagnose
Empfohlene Literatur:
- Elektrische Maschinen, Spring
- Hydraulik und Pneumatik, Watter
- Sensoren in der Automatisierungstechnik, Schnell
- Taschenbuch der Automatisierung, Langmann
- Handbuch Fügen, Handhaben und Montieren, Feldmann
- Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme, Brecher
- Flexible Fertigungssysteme: Entscheidungsunterstützung für Konfiguration und Betrieb, Kuhn
- Produktionswirtschaft, Nebl
- Praxis der Montagetechnik, Konold
- Produktionsmanagement, Syska
- Handbuch Industrie 4.0, Reinhart