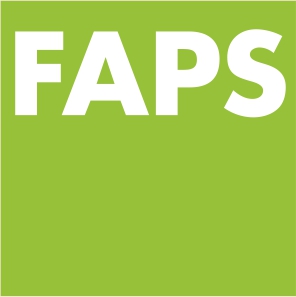Index
Vorlesung und Übung Produktionstechnik II
Vorlesung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 2,5
Modulbezeichnung
Vorlesung und Übung Produktionstechnik II
Dozentinnen/Dozenten Vorlesung
Prof. Dr.-Ing. Nico Hanenkamp, Prof. Dr.-Ing. Dietmar Drummer, Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke
Angaben
Vorlesung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 2,5
für Gasthörer zugelassen, Sprache Deutsch, Die Vorlesung wird gemeinsam mit den Inhalten aus der Vorlesung “Produktionstechnik I” geprüft und kreditiert
Zeit und Ort: Do 12:15 – 13:45, H11
Produktionstechnik II – Tutorium (PTII-TUT)
Dozent/in
Nicolai Ostrowicki, M. Sc.
Angaben
Tutorium, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 2,5
für Gasthörer zugelassen, Sprache Deutsch
Zeit und Ort: Mi 16:15 – 17:45, H11
Studienfächer / Studienrichtungen
PF BPT-BA-M 4 (ECTS-Credits: 2,5)
PF MB-BA 4 (ECTS-Credits: 2,5)
WPF INF-NF-MB ab 5 (ECTS-Credits: 2,5)
PF ME-BA 4 (ECTS-Credits: 2,5)
PF WING-BA-MB 4 (ECTS-Credits: 2,5)
PF MT-BA-GP 4 (ECTS-Credits: 2,5)
WPF MT-BA-BV ab 5 (ECTS-Credits: 2,5)
WPF IPM-MA 1-2 (ECTS-Credits: 2,5)
PF BPT-MA-E-M ab 1
ECTS-Informationen:
Credits: 2,5 für die Vorlesung + 2,5 für das Tutorium
Inhalt:
Produktionstechnik I:
Basierend auf der DIN 8580 werden in der Vorlesung Produktionstechnik I die aktuellen Technologien sowie die dabei eingesetzten Maschinen in den Bereichen Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und das Ändern der Stoffeigenschaften behandelt. Hierbei werden sowohl die Prozessketten als auch die spezifischen Eigenschaften der Produktionstechniken aufgezeigt und anhand von praxisrelevanten Bauteilen erläutert. Zum besseren Verständnis der Verfahren werden zunächst metallkundliche Grundlagen, wie der mikrostrukturelle Aufbau von metallischen Werkstoffen und ihr plastisches Verhalten, erläutert. Anschließend werden die Urformverfahren Gießen und Pulvermetallurgie dargestellt. Im weiteren Verlauf der Vorlesung erfolgt eine Gegenüberstellung der Verfahren der Massivumformung Stauchen, Schmieden, Fließpressen und Walzen. Im Rahmen des Kapitels Blechumformung wird die Herstellung von Bauteilen durch Tiefziehen, Streckziehen und Biegen betrachtet. Der Fokus in der Vorstellung der Verfahrensgruppe Trennen liegt auf den Prozessen des Zerteilens und Spanens. Die Vorlesungseinheit des Bereichs Fügen behandelt die Herstellung von Verbindungen mittels Umformen, Schweißen und Löten. Abschließend werden verschiedene strahlbasierte Fertigungsverfahren aus den sechs Bereichen vorgestellt. Im Fokus stehen hierbei laserbasierte Fertigungsverfahren, wie zum Beispiel Schweißen, Schneiden oder Additiven Fertigung. Eine zusätzlich angebotene Übung dient der Vertiefung und der Anwendung des Vorlesungsinhaltes.
Produktionstechnik II:
Die Vorlesung beschäftigt sich inhaltlich mit der Verarbeitung von Kunststoffen (Spritzgießen, Erzeugung von duroplastischen / thermoplastischen Faserverbunden) und Metallen mit dem Fokus auf strahlbasierten Verfahren (Schneiden, Schweißen und Additive Fertigung mittels Wasser-, Elektronen- und Laserstrahl). Des Weiteren werden die Grundlagen zu Werkzeugmaschinen und dem Werkzeugmaschinenbau (Maschinenkomponenten, Funktionalitäten, Anwendungs- / Einsatzmöglichkeiten) sowie zu Montagetechnologien und Verbindungstechniken (Auslegung von Verbindungen, prozesstechnische Umsetzung und Realisierung) vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt stellen der Elektromaschinenbau und die Elektronikproduktion (Funktionsweise und Herstellung von elektronischen Antriebseinheiten, Auslegung und Herstellung von elektronischen Komponenten) dar.
Lernziele und Kompetenzen:
Wissen
- Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse in der Metallkunde und der Verarbeitung von Metallen.
- Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Produktionsverfahren Urformen, Umformen, Fügen, Trennen, ihre Untergruppen
- Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Prozessverständnis hinsichtlich der wirkenden Mechanismen.
- Die Studierenden erwerben Wissen über die Prozessführung sowie spezifische Eigenschaften der Produktionsverfahren.
- Die Studierenden erwerben grundlegendes Verständnis zu den Eigenschaften von Kuststoffen und deren Verarbeitung
- Die Studierenden erwerben Kenntnisse über werkstoffwissenschaftliche Aspekte und Werkstoffeigenschaften sowie Werkstoffverhalten vor und nach den jeweiligen Bearbeitungsprozessen
- Die Studierenden erwerben fundamentale Kenntnisse zu Multi-Materialien-Verbunden.
- Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse zur Funktionsweise von elektrischen Antriebseinheiten und deren Herstellung sowie die Herstellung von elektrischen Komponenten (MID)
- Die Studierenden erhalten grundlegende Kenntnisse im Bereich der Produktentwicklung und Produktauslegung (Verfahrensmöglichkeiten, Verfahrensgrenzen, Designeinschränkungen, etc.) Verstehen
- Die Studierenden sind in der Lage die grundlegenden Prinzipien von Fertigungsprozessen und der Systemauslegung zu verstehen
- Die Studierenden verstehen die Grundlagen des Anlagen- und Werkzeugbaus Anwenden
- Die Studierenden können geeignete Fertigungsverfahren zur Herstellung technischer Produkte bestimmen (Schwerpunkte: Urformen, Umformen, Fügen, Trennen). Analysieren
- Die Studierenden können die verschiedenen Fertigungsverfahren erkennen und normgerecht differenzieren
Produktionsprozesse in der Elektronik (PRIDE 2)
Modulbezeichnung:
Produktionsprozesse in der Elektronik (PRIDE 2)
(Production Processes for Electronics)
5 ECTS
Modulverantwortliche/r:
Jörg Franke
Startsemester: SS 2019 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (SS)
Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch
Lehrveranstaltungen:
Produktionsprozesse in der Elektronik (SS 2019, Vorlesung, 2 SWS, Jörg Franke et al.)
Übung zu Produktionsprozesse in der Elektronik (SS 2019, Übung, 2 SWS, Jörg Franke et al.)
Inhalt:
Die Vorlesung Produktionsprozesse in der Elektronik (vormals Produktion in der Elektronik 2) behandelt die für die Produktion von elektronischen Baugruppen notwendigen Prozesse, Technologien und Materialien entlang der gesamten Fertigungskette. Dabei wird ausgehend vom Layoutentwurf der Leiterplatte auf die Prozessschritte zur fertigen elektronischen Baugruppe eingegangen. Zudem werden die notwendigen Aspekte der Qualitätssicherung und Materiallogistik und auch das Recycling behandelt.Ergänzend werden die Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen sowie für flexible und dreidimensionale Schaltungsträger betrachtet. Die Übung findet im Rahmen von mehreren Exkursionen zu verschiedenen Unternehmen der Elektronikproduktion statt.
Die Studierenden
- lernen die wesentlichen Prozessschritte zur Herstellung elektronischer Baugruppen (von der Leiterplatte bis zum fertigen Produkt) intensiv kennen.
- können mit diesem Wissen Konzepte für effiziente Fertigungsketten der Elektronikproduktion unter Berücksichtigung technologischer sowie produktionstechnischer Aspekte ableiten.
- lernen die in der Elektronikproduktion eingesetzten lasergestützten Fertigungstechnologien detailliert kennen und sind in der Lage, mit den vermittelten Kenntnissen Konzepte für den Aufbau einer lasergestützten Fertigung von Elektronikkomponenten zu entwickeln.
Lernziele und Kompetenzen:
Die Studenten:
- erläutern die wesentlichen Prozessschritte zur Herstellung elektronischer Baugruppen von der Leiterplatte bis zum fertigen Produkt.
- entwickeln Konzepte für effiziente Fertigungsketten der Elektronikproduktion unter Berücksichtigung technologischer sowie produktionstechnischer Aspekte.
- vergleichen die Verfahren der Aufbau- und Verbindungstechnik anhand der spezifischen Eigenschaften.
Literatur:
gleichnamiges Vorlesungsskript und die darin enthaltenen Hinweise auf weiterführende Literatur.
Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:
Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:
[1] Maschinenbau (Master of Science): 1. Semester
(Po-Vers. 2013 | Studienrichtung International Production Engineering and Management | Gesamtkonto)
Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern “Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science)”, “Berufspädagogik Technik (Master of Education)”, “Mechatronik (Bachelor of Science)”, “Mechatronik (Master of Science)”, “Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science)” verwendbar.
Studien-/Prüfungsleistungen:
Produktionsprozesse in der Elektronik (Vorlesung + Übung) (Prüfungsnummer: 71221)
(englische Bezeichnung: Production Processes for Electronics)
Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90
Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
- Produktionsprozesse in der Elektronik
- Übung zu Produktionsprozesse in der Elektronik
Erstablegung: SS 2019, 1. Wdh.: WS 2019/2020
1. Prüfer: Jörg Franke
Organisatorisches:
Prüfung:
schriftlich, 90 min. zusammen mit den Inhalten der Übung zu Produktionsprozesse in der Elektronik
Für die Prüfung sind ausschließlich folgende Hilfsmittel zugelassen:
- nicht programmierbarer Taschenrechner
- dokumentenechter Stift
- Textmarker
- Lineal, Geodreieck, Zirkel
- Namensstempel
Darüber hinaus sind keine weiteren Hilfsmittel erlaubt (dies gilt insbesondere für Uhren, Mobiltelefone oder sonstige elektronische Geräte).
Handhabungs- und Montagetechnik (HUM)
Vorlesung und Übung, 4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 5
Inhalt:
Im Vertiefungsfach Handhabungs- und Montagetechnik wird die gesamte Verfahrenskette von der Montageplanung bis zur Inbetriebnahme der Montageanlagen für mechanische sowie elektrotechnische Produkte aufgezeigt. Einleitend erfolgt die Darstellung von Planungsverfahren sowie rechnergestützte Hilfsmittel in der Montageplanung. Daran schließt sich die Besprechung von Einrichtungen zur Werkstück- und Betriebsmittelhandhabung in flexiblen Fertigungssytemen und für den zellenübergreifenden Materialfluss an. Des Weiteren werden Systeme in der mechanischen Montage von Klein- und Großgeräten, der elektromechanischen Montage und die gesamte Verfahrenskette in der elektrotechnischen Montage diskutiert (Anforderung, Modellierung, Simulation, Montagestrukturen, Wirtschaftlichkeit etc.). Abrundend werden Möglichkeiten zur rechnergestützten Diagnose/Qualitätssicherung und Fragestellungen zu Personalmanagement in der Montage und zum Produktrecycling/-demontage behandelt.
Die Veranstaltung vermittelt das erforderliche Wissen um,
- die Montagefreundlichkeit von Produkten zu beurteilen und zu verbessern,
- Montage- und Handhabungsprozesse zu beurteilen, auszuwählen und zu optimieren,
- die dazu erforderlichen Geräte, Vorrichtungen und Werkzeuge zu bewerten, und
- Montageprozesse sowie -systeme zu konzipieren, zu planen und weiterzuentwickeln.
Dieses Wissen ist vor allem in den Bereichen Produktentwicklung, Konstruktion, Produktionsmanagement, Fertigungsplanung, Einkauf, Vertrieb und Management sowie in allen industriellen Branchen (z. B. Automobilbau, Elektrotechnik, Medizintechnik, Maschinen- und Anlagenbau) erforderlich.
Praktikum Mechatronische Systeme (MechSysPrak)
Vorlesung und Übung, 6 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 5
Voraussetzungen / Organisatorisches:
Die Anmeldung zum Kurs erfolgt über StudON. Anmeldung ist nötig! Die Anmeldung zu den Praktikumsgruppen ist zwischen dem 03.04.2019, 10:00 Uhr und 16.04.2019, 10:00 Uhr möglich. Link zur StudOn-Seite: https://www.studon.fau.de/crs2401888.html
ECTS-Informationen:
Title: Laboratory on Mechatronic Systems
Credits: 5
Zusätzliche Informationen:
Schlagwörter: Mechatronik, Praktikum Mechatronische Systeme
Erwartete Teilnehmerzahl: 100
Für diese Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt von Mittwoch, 27.3.2019, 00:00 Uhr bis Dienstag, 16.4.2019, 10:00 Uhr über: StudOn.
UnivIS Infoseite
Lehrstuhl Infoseite
Institution: Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente
MHI Industrie 4.0 für Ingenieure (MHI4.0)
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Inhalt:
Ausgangslage
- Industrie 4.0 bzw. IoT ist ein globaler Megatrend, der nahezu alle Branchen der heutigen Industrie prägt
- Praktische Ausprägung und Umsetzungsstrategien sind noch Gegenstand der Forschung
Motivation der Vorlesung
- Industrie 4.0 Themen werden heute noch nicht gelehrt
- Interdisziplinäres Themenfeld mit sehr großem Umfang
- Hohe Dynamik und enorme Fortentwicklung der Thematik und Technik
Konzept der Vorlesung
- Präsenzvorlesung mit virtuellem Charakter
- Offene, wandelbare Veranstaltung mit wechselnden Dozenten
- Jedes Institut der MHI stellt hierbei eine Vorlesungseinheit, welche als Videoaufnahme ausgestrahlt oder zeitgleich per Videostream in die Vorlesungsräume aller weiteren teilnehmenden Institute gestreamt wird
- Bündelung der nationalen wissenschaftlichen Kompetenzen in diesem Themenfeld
Voraussetzungen / Organisatorisches:
Ansprechpartner für Vorlesung und Anmeldung: Dominik Kißkalt, M. Sc.
Zulassungsvoraussetzung: Eingeschriebene/r Bachelor- oder Masterstudent/in aus den oben genannten Studiengängen
Anmeldung: ab dem 01.04.2019 über StudOn (Teilnehmerzahl ist begrenzt!)
Prüfung: schriftlich, voraussichtlich ca. 2-3 Wochen nach der Vorlesungszeit Verwendung als Wahlfach mit 2,5 ECTS; Umfang von 12 Vorlesungseinheiten
Zusätzliche Informationen:
Erwartete Teilnehmerzahl: 30, Maximale Teilnehmerzahl: 30
Industrie 4.0 für Ingenieure (I4I)
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Inhalt:
Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik bietet im Sommersemester die Vorlesung „Industrie 4.0 für Ingenieure“ als technisches und nicht-technisches Wahlfach an. Diese Ringvorlesung wird von renommierten Mitgliedern der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Montage, Handhabung und Industrierobotik (MHI, www.wgmhi.de) gehalten, die ausgehend von ihren jeweiligen Fachgebieten in den Themenkomplex „Industrie 4.0“ einführen. Folgende Themengebiete rund um die Digitalisierung werden unter anderem behandelt:
- Industrierobotik
- Netzwerk- und Cloudtechnologien
- Software und Steuerung
- Der Mensch in I4.0
- Industrial Data Science
Lernziele und Kompetenzen:
Den Studierenden sollen die Auswirkungen und technischen Ausprägungen des Zukunftsprojekts Industrie 4.0 verdeutlicht und dadurch ein Bewusstsein für diese Entwicklungen geschaffen werden. Zusätzlich soll ein Verständnis für Geschäftstreiber, technische Möglichkeiten und deren Wechselwirkungen sowie branchen- und domänenübergreifende Prozesse und Methoden vermittelt werden.
Die Studierenden sind nach Besuch der Lehrveranstaltung in der Lage:
- die kontroversen und vielschichtigen Diskussionen im Umfeld von Industrie 4.0 in einen konsistenten Gesamtkontext einzuordnen
- anhand repräsentativer Beispiele den Unterschied zwischen dem aktuellen Stand der Technik und Forschung sowie den durch Industrie 4.0 postulierten Innovationshypothesen zu verstehen
Organisatorisches:
Die Vorlesung wird in 12 Vorlesungseinheiten angeboten, in denen unterschiedliche Bereiche der Thematik vorgestellt, diskutiert und vertieft werden. Am Ende des Semesters wird eine Klausur angeboten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei den Ansprechpartnern am Lehrstuhl FAPS: Jonathan Fuchs und Dominik Kisskalt
Für die Prüfung sind ausschließlich folgende Hilfsmittel zugelassen:
- nicht programmierbarer Taschenrechner
- dokumentenechter Stift
- Textmarker
- Lineal, Geodreieck, Zirkel
- Namensstempel
Darüber hinaus sind keine weiteren Hilfsmittel erlaubt (dies gilt insbesondere für Uhren, Mobiltelefone oder sonstige elektronische Geräte).
Engineering von Industrieanlagen (EIA)2
Vorlesung und Übung, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credit: 2,5
Inhalt:
Der Industrie-Anlagenbau ist durch hohe technische Komplexität und ein hohes Maß geschäftlicher Risiken gekennzeichnet. Dieses Geschäft hat allerdings für Hochlohnländer wie Deutschland eine strategische Bedeutung: Einerseits ermöglicht die Beherrschung dieser Art von Geschäft die Generierung von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, da aufgrund der Komplexität ein „Kopieren” für Mitbewerber nicht zielführend ist. Andererseits generiert diese Geschäftsart aufgrund der engen Zusammenarbeit mit konkreten Kunden permanent Innovationsideen, welche direkt am Markt eingesetzt und erprobt werden können, sodass dadurch eine Zukunftsorientierung und -sicherung gegeben ist. Allerdings gibt es derzeit keine wissenschaftliche Community, die sich dieser Fragestellung umfassend annimmt. Es ist daher wichtig, den nachwachsenden Generationen von Jungingenieuren die strategische Bedeutung des Themas und mögliche Lösungskonzepte frühzeitig zu vermitteln.
Lernziele und Kompetenzen:
Die Studierenden sollen ein Bewusstsein im Hinblick auf die Potentiale und Risiken des Projektgeschäfts, des Engineerings bzw. der Systemintegration im Kontext von Industrieanlagen entwickeln. Dazu werden branchen- und domänenübergreifende Engineering-Konzepte, -Methoden und -Prozesse vermittelt.
Die Vorlesung ist auf Basis der folgenden Leitlinien aufgebaut:
- Startpunkt aller Betrachtungen sind jeweils die Treiber aus geschäftlicher und technischer Sicht, die in ihren prinzipiellen Wechselwirkungen untereinander betrachtet werden. Auf dieser Basis werden die Anforderungen an Lösungsansätze bezüglich Geschäftsmodellen, Strategien, Konzepten und Methoden abgeleitet und diskutiert.
- Die behandelten Themen werden durch praktische Beispiele aus dem Umfeld des Siemens Konzerns illustriert. Ziel ist dabei, Beispiele aus möglichst unterschiedlichen Geschäften (z.B. Walzwerke, Kraftwerke, Energieübertragung und -verteilung, Logistik, etc.) zu nutzen, um die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede transparent zu machen.
- Die vorgestellten branchen- und domänenübergreifenden Lösungsansätze in Form von Strategien, Konzepten, Methoden, etc. werden in ein gesamtheitliches Rahmenwerk eingeordnet, um so die Querbezüge und Abhängigkeiten zu verdeutlichen.
Die Studierenden sind nach Besuch der Lehrveranstaltung in der Lage
- die geschäftlichen und technischen Treiber und Herausforderungen im Kontext des Industrieanlagen-Geschäfts umfassend zu verstehen,
- grundsätzliche Ansätze der Modellbildung bezüglich Systemen und Prozessen zu unterscheiden und zu nutzen
- sowie branchen- und domänenübergreifende Engineering-Konzepte, – Methoden und -Prozesse als Basis für eine konkrete Anwendung beurteilen zu können
Das im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vermittelte Wissen ist in allen Bereichen der projektbasierten industriellen Branchen, so z. B. im allgemeinen Maschinen-, insbesondere aber im (Groß-) Anlagenbau erforderlich.
Organisatorisches:
Für die Prüfung sind ausschließlich folgende Hilfsmittel zugelassen:
- nicht programmierbarer Taschenrechner
- dokumentenechter Stift
- Textmarker
- Lineal, Geodreieck, Zirkel
- Namensstempel
Darüber hinaus sind keine weiteren Hilfsmittel erlaubt (dies gilt insbesondere für Uhren, Mobiltelefone oder sonstige elektronische Geräte).
Integrated Production Systems
Online Course via the Bavarian Virtual University
4 SWS / 5 ECTS
Abstract:
Participants of this course get an overview about the tasks of a manufacturing manager with the
background of an international acting company.
- Motivation, philosophy and targets
- Methods und tools
- Experiences from industrial praxis
- Overview of the current situation of production systems of global acting companies
Content of the lecture units:
- Historical derivation, definition and fundamental terms of traditional and integrated production systems (Taylorism and its realization by Henry Ford); critical analysis of the classic methods division of responsibilities/work; Lean Production as solution approach of the mentioned problems;
- Description of elemental pillars of integrated production systems (continuous improvement process; Total Quality Management; value stream method; flow principle, role of the employees in the context of Lean Management)
- Methods und tools of the continuous improvement process: Ishikawa-diagram Pareto-Analysis, A3-report, 5-W
- Process-oriented production: differentiation to technology orientated production; description of the central elements of flow orientated production: Kanban, Just in Time, One Piece Flow, Heijunka
- Global production networks in the context of Supply Chain Management: fundamentals of Supply Chain Management, supply chain structures, supply chain strategies
- Fundamentals, elements and tools of Total Quality Managements (TQM): client orientation in the background of globalization, staff retention und assistance, risks of the implementation of TQM, Overall Equipment Efficiency (OEE) as a measuring instrument
- Jidoka and Low Cost Automation: explanation of the Jidoka-principle and the associated tools (Poka Yoke, Andon-schemes), description of the Low Cost Automation (LCA) -philosophy (5-level principle); guidelines and checklists for the introduction of LCA-systems
- Total Productive Maintenance: Descriptions of seven steps for the realization of TPM, overview of tools of TPM: Makigami, value stream method, etc.; transfer of the TPM- principle into praxis
- Material- und energy efficiency: measuring methods for the determination of consumptions; strategies for reduce wastage; methods for the realization of energy saving potentials in praxis; transfer of the lean idea to the energy value stream
- Transfer of the lean idea to the provision of information und its distribution, CAD/CAM-process PLM, ERP
- Lean Development: Introduction in the product development according to the lean principle; Methods and tools for the support of the product development, instruments for result control measurement
- Lean Administration: transfer of the lean methods on administrative and management processes; identification of administrational processes and their corresponding parts on wastage.
- Repetition of the contents and preparation for the exam.
Online course elements:
- Lectures for download (English) and additional Videos
- Online discussion in a forum (English and German)
- Telecom and email contact to the responsible supervisor of each lecture (English and German)
- Interactive online portal for practice (English and German)
- Literature list for additional information via download (English)
Requirements for examination:
- Fundamentals in production engineering and economy are recommended.
- An examination can take place simultaneously at all requesting universities. If it is requested. It can take place at foreign partner universities too, if there are students from partaking universities.
Learning and qualification target:
With the graduation of integrated production systems, you should be able to:
- Conceive the major characteristics of the lean idea
- Know and interiorize the meaning of the existing lean-principles
- Know the principle and the targets of the continuous improvement process, and apply the most important methods and technics
- Understand the difference between a technology and process orientated production
- Know the reasons, possible structures and main principles of a global production and the corresponding supply chains
- Conceive the principle and the targets of the TQM-approach and be able to apply its most important methods and techniques
- Understand the principle of Jidoka and the resulting potentials
- Apply the concept of TPM and its eight pillars
- Quantify the route an influence factors of material and energy flows in producing companies
- Understand the meaning of information in production processes
- Know the fundamentals and essentials of lean development und lean administration
Tags: Production engineering, integrated productions systems, management
Suitable for: Master students of all technical study paths
Competent examination office: Examination office of the home university of the students
Authorized aids during the examination: Non-programmable calculator
Formal requirements for the participation in the examination: All three case studies have to be passed and a registration via the vhb has to be made.